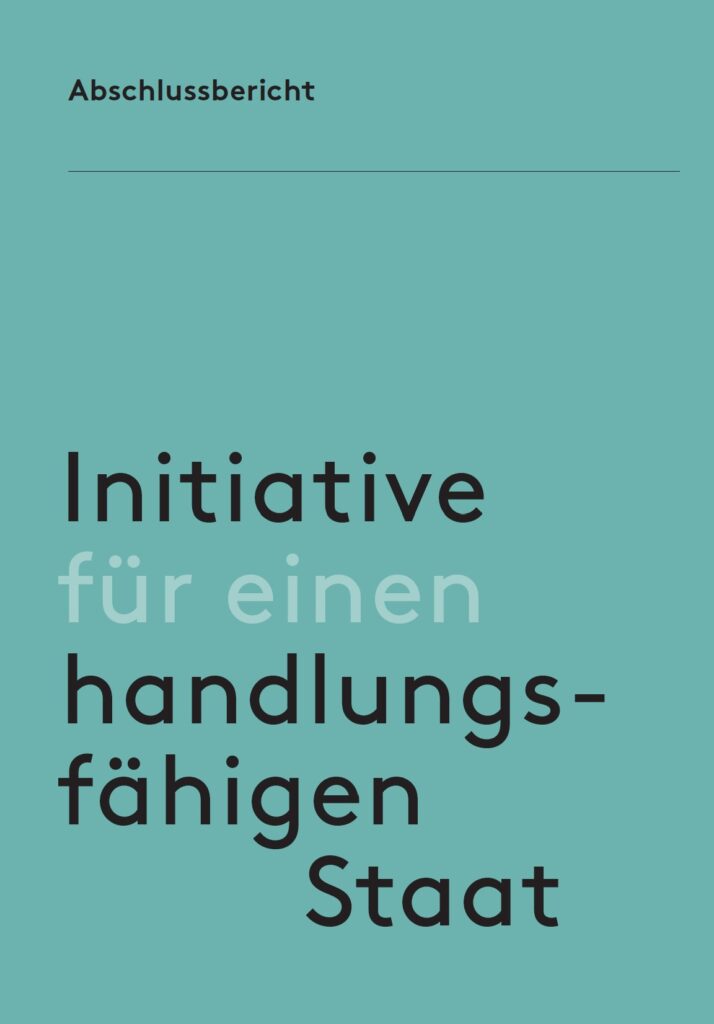35 Empfehlungen für einen handlungsfähigen Staat
Nur noch 23 % der Bevölkerung haben das Vertrauen in den Staat, dass er in der Lage ist, die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern. So lautet das ernüchternde Ergebnis der neuesten „dbb Bürgerbefragung Öffentlicher Dienst“ des Deutschen Beamtenbundes (dbb). Damit sinkt das Vertrauen der Bürger:innen bereits das fünfte Jahr in Folge. Um diesem Vertrauensverlust entgegenzuwirken, hat sich die unabhängige Initiative für einen handlungsfähigen Staat gegründet. Ihr Abschlussbericht liefert 35 konkrete Empfehlungen, wie Reformen gelingen können und das Vertrauen der Bürger: innen zurückgewonnen werden kann. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Eine aktuelle Befragung des dbb zeigt, wie dramatisch das Vertrauen in staatliches Handeln gesunken ist. Nur noch 23 % der Bürger:innen trauen dem Staat überhaupt zu, seine Aufgaben zu bewältigen. Ganze 73 % halten ihn für überfordert. Die Befragten nannten allen voran die Themenfelder Asylund Flüchtlingspolitik (30 %), soziale Sicherung und Rente (16 %) sowie Bildung und Schule (15 %). Nur 22 % der Befragten glauben, dass die Koalition von CDU/CSU und SPD die Leistungsfähigkeit des Staates verbessern wird. Dabei sehen 56 % aller Befragten Handlungsbedarf auf allen staatlichen Ebenen – von Kommune bis Bund. Besonders häufig werden als Lösung genannt: Weniger Vorschriften, kürzere Bearbeitungszeiten, bessere Digitalisierung.
Vertrauen zurückgewinnen
Die Initiative für einen handlungsfähigen Staat, gegründet 2024 unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, hat sich zum Ziel gesetzt, Vorschläge für eine Staatsreform zu erarbeiten: Staat und Verwaltung sollen modernisiert und handlungsfähiger, das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewonnen werden. Hinter der Initiative stehen Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Die Initiator:innen sind Julia Jäkel, Thomas de Maizière, Peer Steinbrück und Andreas Voßkuhle. Mitgetragen wird das Projekt von der ZEIT Stiftung, der Stiftung Mercator, der Hertie-Stiftung und der Fritz Thyssen Stiftung.
Wettbewerbsfähigkeit von zentraler Bedeutung
Der Abschlussbericht der Initiative wurde Mitte Juli im Schloss Bellevue präsentiert. Die 35 konstruktiven Empfehlungen sind in elf Kapitel untergliedert: Gesetzgebung, Digitaler Staat und Verwaltung, Sicherheit, Abschiebungen und Datenaustausch, Wettbewerbsfähigkeit, Datenschutz, Klima, Soziales, Bildung sowie Leitlinien. Erarbeitet wurden sie von sieben Gruppen mit insgesam 54 Expert:innen sowie jungen Praktiker:innen aus dem Alumni-Netzwerk der beteiligten Stiftungen. Das Thema der Wettbewerbsfähigkeit erhielt ein eigenes Kapitel mit vier Empfehlungen. Zudem betont die Initiative die Bedeutung der Wettbewerbsfähigkeit, die sich durch nahezu alle Kapitel des Berichts zieht. Ein handlungsfähiger Staat, der Innovationen fördert und Bremsklötze löst, sei Grundvoraussetzung für eine wirtschaftliche Dynamik, die im globalen Wettbewerb seit Jahren ungenügend ist.
Konkrete Empfehlungen
Es folgt hier ein gekürzter Überblick über die vier zentralen Empfehlungen zur Wettbewerbsfähigkeit, die im Abschlussbericht ab Seite 85 im Detail nachzulesen sind.
1. Empfehlung: „Planen, Vergeben, Beschaffen: Der Staat erleichtert Investitionen.“
Konkret werden weniger Dokumentations- und Nachweispflichten, stattdessen klarere Gebote und Verbote vorgeschlagen. „Grundsätzlich sollte der Staat aber Unternehmen mehr Vertrauen entgegenbringen und die Regeleinhaltung mit Stichproben kontrollieren.“ Öffentliche Beschaffungen sollen vereinfacht und digitalisiert werden. Die Kritik: „Unser Staat beschafft zu kompliziert und nicht wirtschaftlich.“ Die Betreuung großer Infrastrukturvorhaben sollte in spezialisierten und mit erfahrenen Kräften besetzten Zentren auf Landesebene gebündelt werden: „Unsere sektoral aufgebaute Verwaltung muss auf diese Weise zusammengeführt werden.“ Steigende Kosten und Anpassungen aufgrund zusätzlicher rechtlicher Anforderungen während der Planungs- und Realisierungsphase von Infrastrukturvorhaben sollten, wenn möglich, mithilfe von Präklusionsregelungen verhindert werden. „Irgendwann muss Schluss sein.“
2. Empfehlung: „Der Staat übernimmt die Rolle eines strategischen Auftraggebers und Investors.“
Da der Staat der größte Auftraggeber und Abnehmer von Produkten und Dienstleistungen im Land ist, soll er seine Position strategisch nutzen: Rahmenbedingungen und Expertise für Public Private Partnerships sollten ausgebaut werden, gezielte Förderprogramme deutsche Start-ups in der Wachstumsphase unterstützen. Der Staat soll als fähiger Auftraggeber innovationsorientiert und risikobereit junge Unternehmen beauftragen. Rückgriff auf Technologieerfahrung und Best-Practice-Ansätze aus der Wirtschaft: Es existiert „eine Scheu, auf Standardangebote von privaten Anbietern zurückzugreifen. Dies muss sich ändern.“ Der Staat muss bei den Themen Sicherheit und Verteidigung ein strategischer Auftraggeber „auch über den bisherigen Bereich der klassischen Rüstungsindustrie hinaus“ werden. Die Initiative nennt insbesondere die Bereiche Forschung, Innovation und Beschaffung.
3. Empfehlung: „Der Staat stärkt die Verknüpfung von Universitäten und Unternehmen.“
Die deutsche Industrie zählt zu den forschungsstärksten weltweit, dennoch ist Deutschland bei der Umsetzung von Forschung in Patente, beim Transfer in die Industrie, den Mittelstand und ganz besonders bei Unternehmensneugründungen und -ausgründungen im internationalen Vergleich deutlich zurückgefallen. Deshalb soll künftig die Verantwortung für Wissenschaft im für Forschung zuständigen Ministerium gebündelt werden. Es braucht mehr Gestaltungsspielräume an der Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft. Die Initiative empfiehlt, dass Hochschulen Entrepreneurship Education in die Lehrpläne integrieren und durch gezielte Programme fördern. Zudem müsse der Wettbewerb um Dritt- und Projektmittel einfacher werden. Nach dem Vorbild UnternehmerTUM der Technischen Universität München sollen Strukturen geschaffen werden, damit Hochschulen den Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesellschaft fördern.
4. Empfehlung: „Deutschland braucht Einwanderer – Aufnahmeverfahren und Integration werden verbessert.“
Die Auswirkungen des demografischen Wandels sind bekannt. Deutschland braucht in Zukunft Fachkräfte auch aus dem Ausland, um Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und soziale Sicherungssysteme zu erhalten. Die Initiative empfiehlt, dass der Bund die Zuständigkeit für Integrationsmaßnahmen an die Länder übergibt. Die Verfahren für den Zugang zum Arbeitsmarkt sollen beschleunigt werden. Ein digitales One-stop-eGovernment soll öffentliche Dienstleistungen an einem Ort und aus einer Hand bündeln. Ausländerbehörden würden als zentrale Anlaufstelle fungieren, vorausgesetzt sie erhalten bessere personelle und technische Ausstattung.
Fazit der Initiative
Mit dem Vorlegen des Abschlussberichts beendet die Initiative ihre Arbeit, sie wollte immer Impulsgeber und kein ständiges Kontroll- oder Beratungsgremium sein. Dennoch appelliert sie an Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, an den Reformen dranzubleiben, auch wenn Veränderungen kosten, mühsam, ressourcenintensiv und von Widerständen begleitet sind.
Vorheriger Artikel der Ausgabe
Was kostet Zukunft?
Nächster Artikel der Ausgabe
Investieren dank Schulden: Wie generationengerecht sind die Regierungspläne?
Weiter Beiträge zum Thema
Die US-Wahl und deren Folgen für die deutsche Wirtschaft
Die US-Wahl und deren Folgen für die deutsche Wirtschaft ...
Nach der Wahl ist vor dem Koalitionsvertrag
Nach der Wahl ist vor dem Koalitionsvertrag ...
„Internationalisierung beginnt im eigenen Netzwerk“
„Internationalisierung beginnt im eigenen Netzwerk“ ...